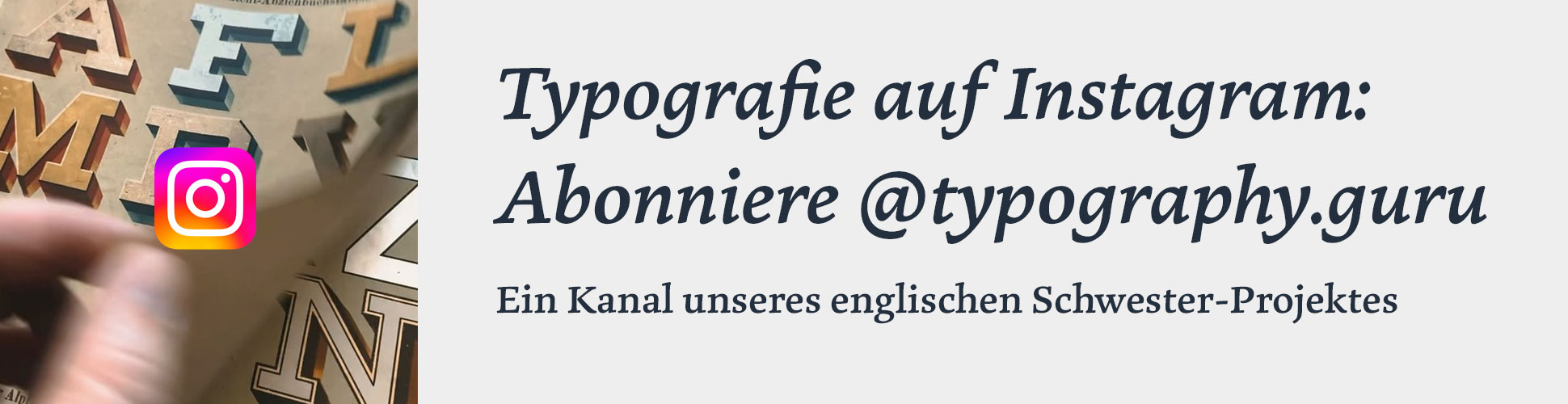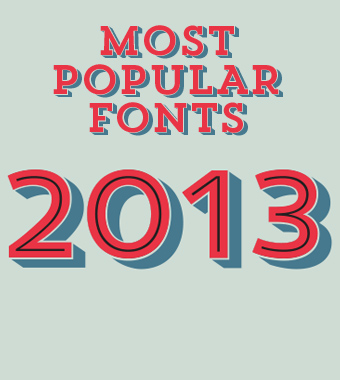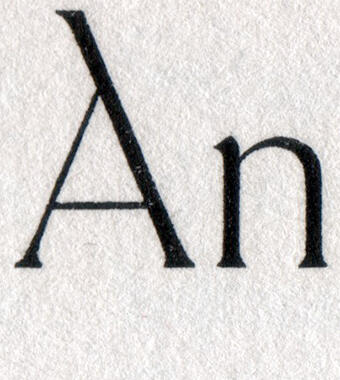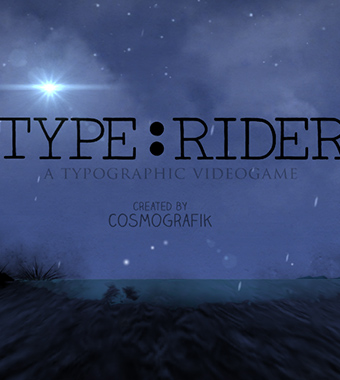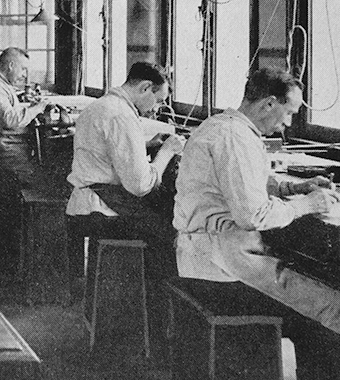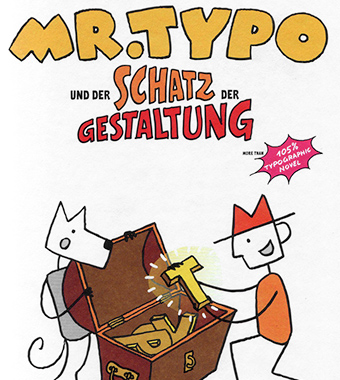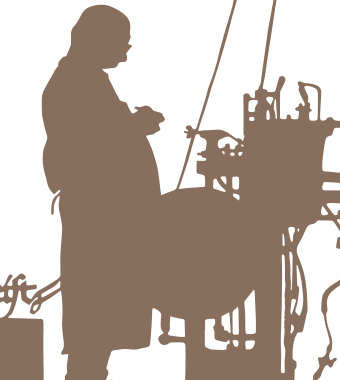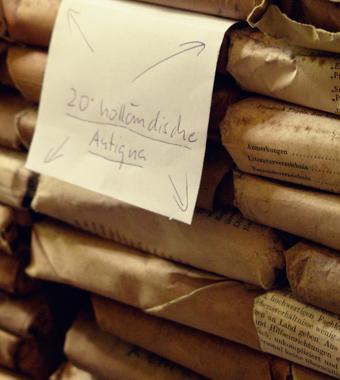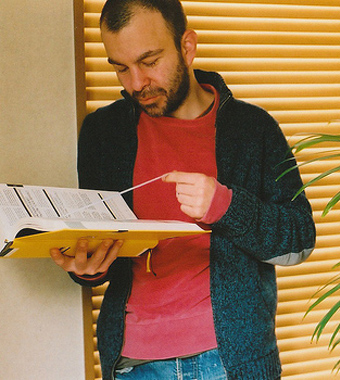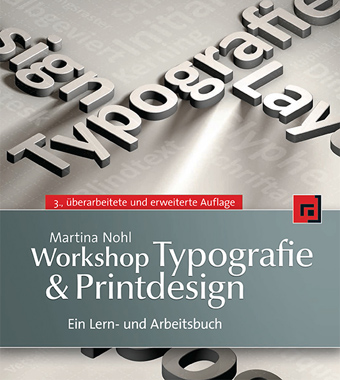Trend von Daniel Hernández (Latinotype)
Quadon von Rene Bieder
Cantoni von Debi Sementelli
Hurme Geometric Sans 4 von Toni Hurme
Desire von Charles Borges de Oliveira
Charcuterie von Laura Worthington
Brandon Text von Hannes von Döhren
Wishes Script von Sabrina Mariela Lopez
Metro Nova von Toshi Omagari
No. Seven von Emil Karl Bertell
Clavo von Michał Jarociński
Style Script von Rob Leuschke
Core Circus von Hyun-Seung Lee, Dae-Hoon Hahm, Min-Joo Ham
Thirsty Rough von Ryan Martinson
Corbert von Jonathan Hill
Weitere Bestenlisten:
Typefacts – Die besten Fonts 2013 FontShop Best Type 2013 The Next Web — The best typefaces of 2013