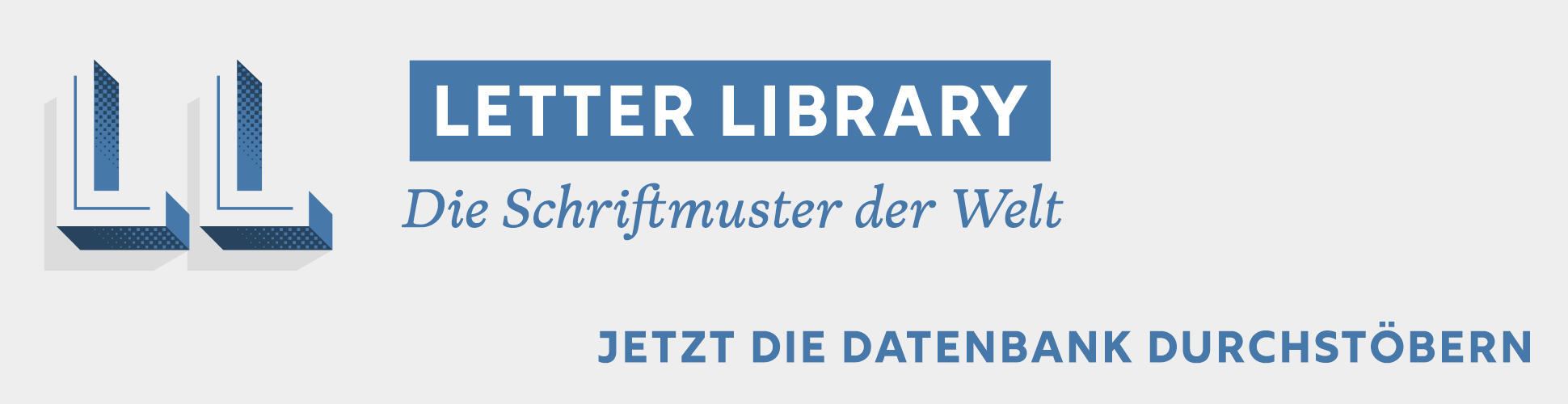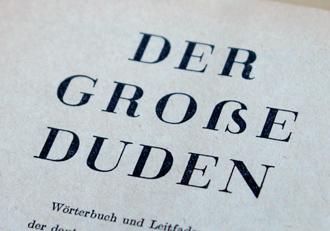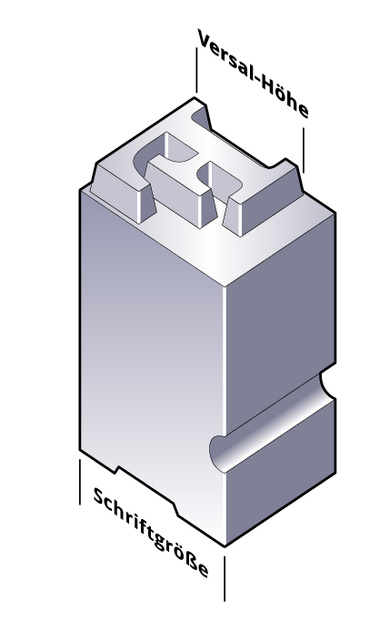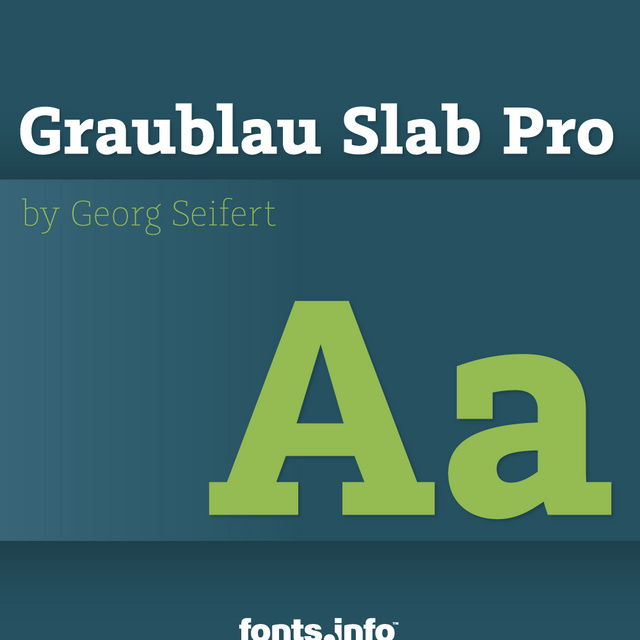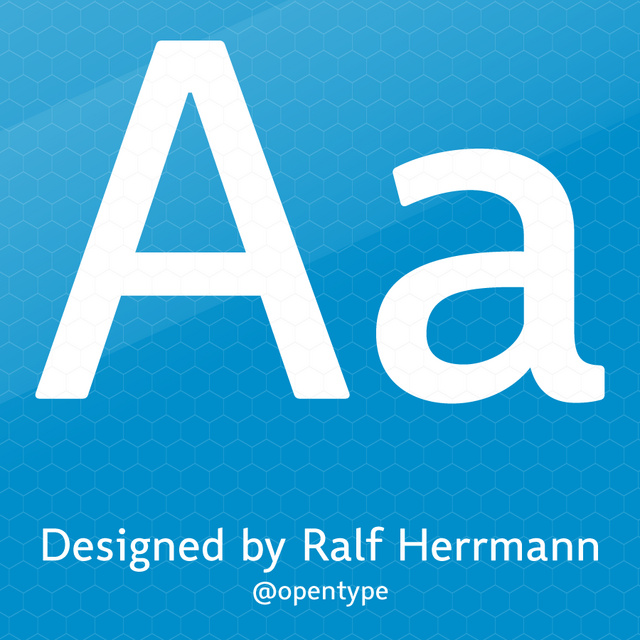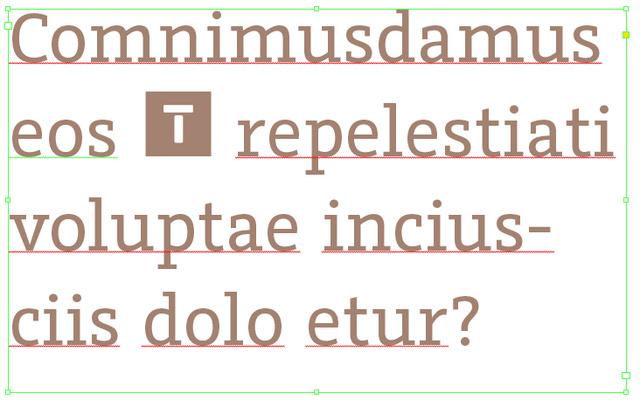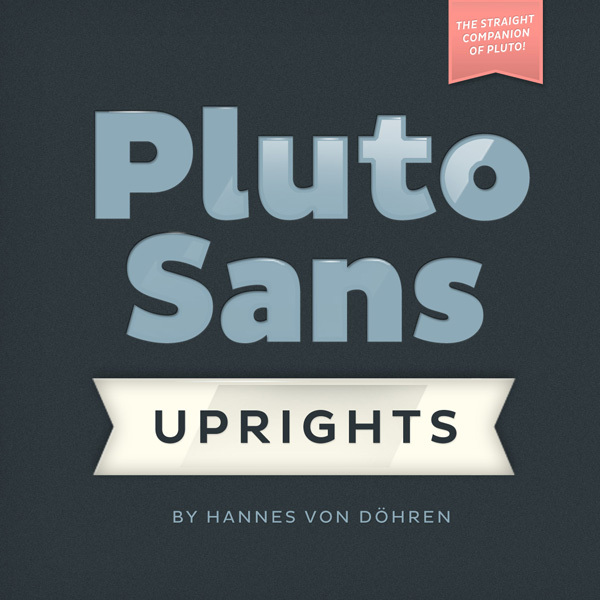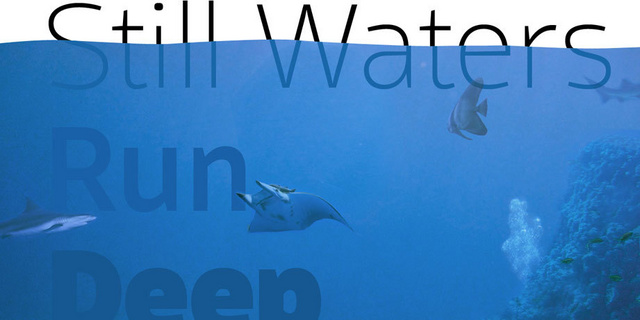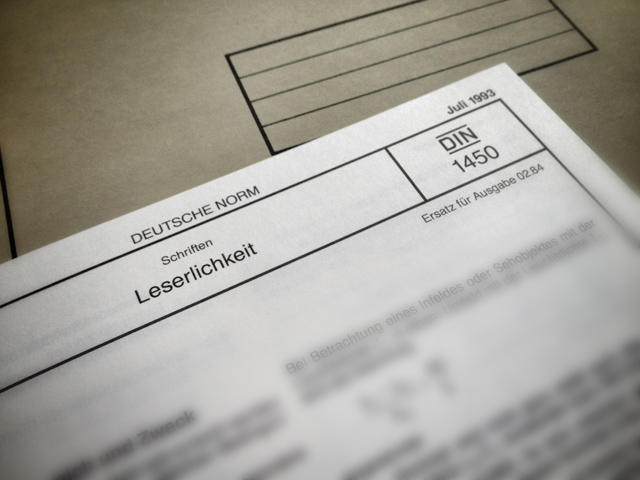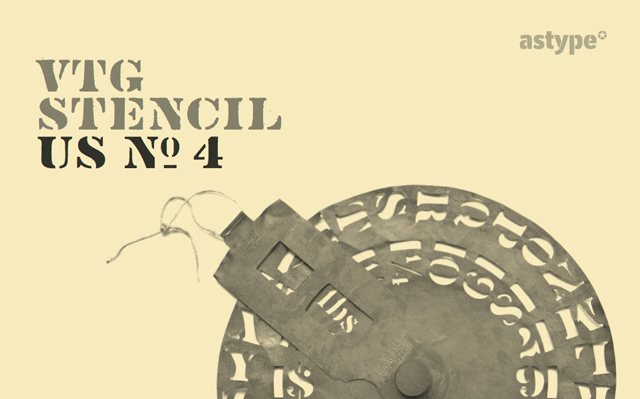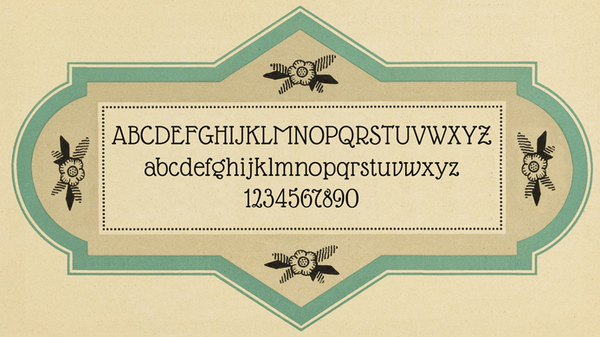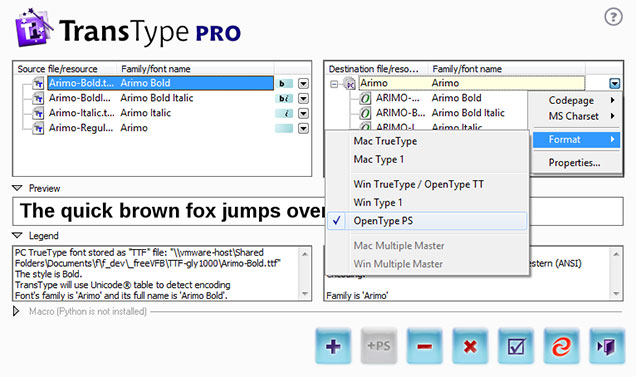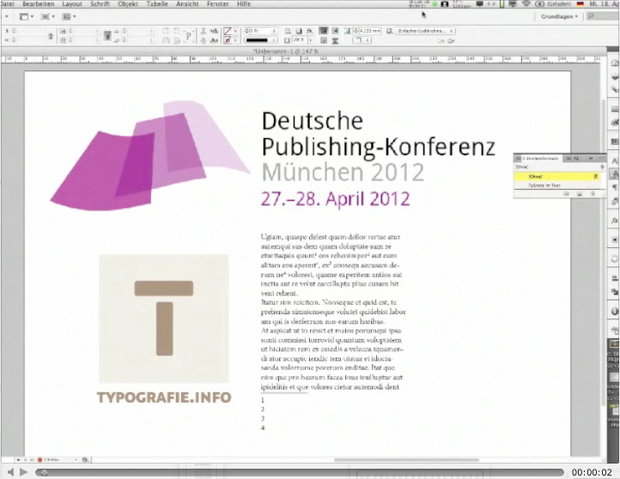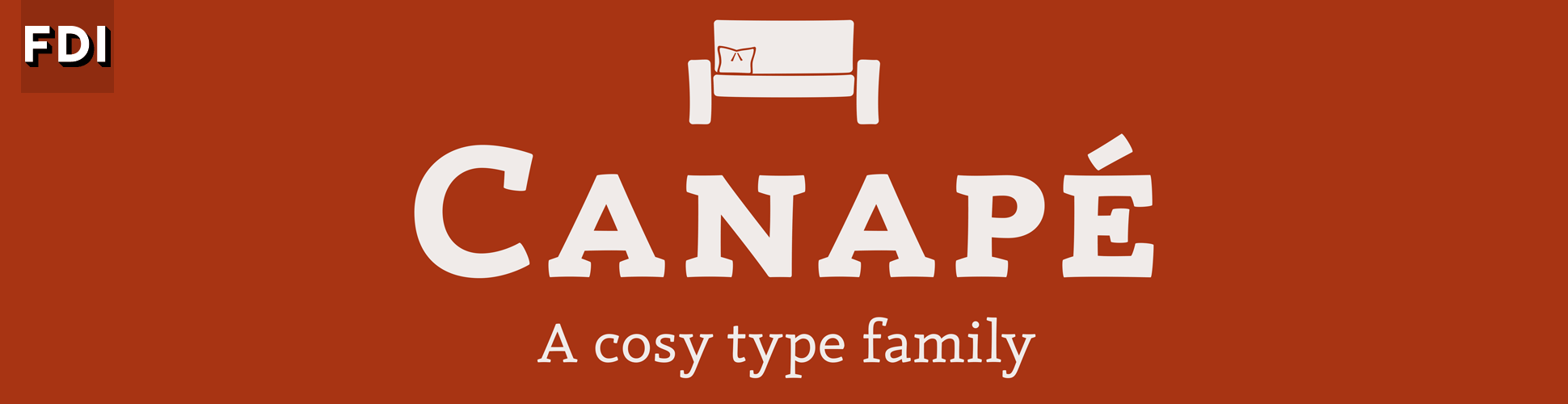Doch wann immer Menschen zum ersten Mal von diesem Thema hören, wiederholen sich die immer gleichen Diskussionen um die Probleme, die der fehlende Buchstabe verursacht oder nicht verursacht, wie man gegebenenfalls mit diesen Problemen umgehen könnte und wie die geschichtlichen Zusammenhänge sind. Diesen Fragen widmen sich zwar bereits Artikel in verschiedensten Fachpublikation wie Signa, TypoJournal und Gutenberg-Jahrbuch ausführlich, jedoch möchte nicht jeder Interessierte gleich Geld ausgeben, um sich über dieses Thema zu informieren.
Daher haben wir unseren Artikel zum großen Eszett aus dem TypoJournal 3 herausgelöst und bieten ihn als druckfähiges A4-PDF zum Gratisdownload an. Das Dokument kann unter der dauerhaft eingerichteten Download-Adresse http://j.mp/versaleszett heruntergeladen werden.
Solange das PDF unverändert bleibt, ist übrigens eine Weitergabe per E-Mail, die Zurverfügungstellung auf anderen Webseite etc. ausdrücklich gestattet.
PDF-Artikel hier herunterladen: http://j.mp/versaleszett